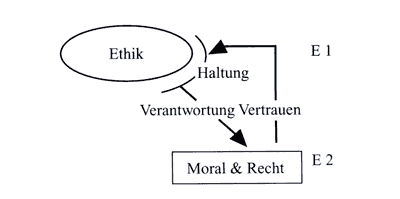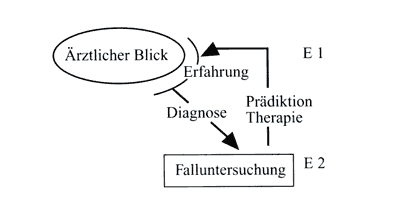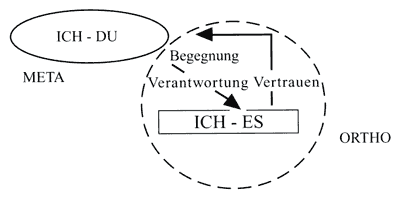| Ethische Probleme in der Chemotherapie |
|
Univ.-Prof. DDr. Karl Hermann Spitzy |
|
|
|
Die Chemotherapie nimmt unter den Arzneimitteltherapien eine Sonderstellung ein. Sie ist suppressive Therapie zum Unterschied von der Ersatztherapie als substitiver und von der Ausgleichs- oder Anstoßtherapie als kompensatorischer [1]. Das Ideal einer medikamentösen Behandlung ist die Substitution, der Ersatz von fehlenden Substanzen wie Wasser, Salze, Nahrungsmittel, inklusive einer nötigen Zufuhr von Vitaminen, Hormonen, Enzymen, Antigenen etc. Die Kompensation soll Stoffwechselgleichgewichte wiederherstellen. Dieses erreicht sie durch Hemmung oder Förderung innerhalb von Stoffwechselabläufen. Da die Natur durch Autopoiese stets selbst bestrebt ist, Gleichgewichte wiederherzustellen, kann das auch im Anstoßprinzip geschehen. Das kann so weit gehen, daß Substanzen, denen sowohl Hemmung wie Förderung zugeschrieben wird, zwar nicht wirken könnten, weil sich ihre Wirkungen aufheben würden, oder auch Substanzen, die gar keine Wirkung haben sollten, wie das Placebo, trotzdem wirksam sind, weil ein Anstoß genügen kann, das "Pendel" wieder in die richtige Richtung schwingen zu lassen. Viele sogenannte Naturheilmethoden können in dieser Art wirksam werden [2]. Chemotherapie ist nicht nur eine Behandlung mit chemischen Substanzen, sondern mit Stoffen, die selektiv toxisch sind. Paul Ehrlich, der Begründer der Chemotherapie, ging von dem Gedanken aus, daß Farbstoffe, wie das Methylenblau oder Trypanrot bestimmte Gewebe selektiv anfärben und dabei im Fall der Vitalfärbung das umgebende Gewebe nicht oder nur wenig schädigen. Diese Ende des 19. Jahrhunderts bereits übliche histologische Anfärbungsmethode wollte er von der in vitro Methode auf eine in vivo Anwendung übertragen. Seine ersten erfolgreichen Versuche galten der Wirkung des Methylenblaus auf den Malariaparasiten [3]. Als störende Nebenwirkung beobachtete er spastische Blasenreizung mit vermehrtem Harndrang. Der nächste Schritt war die Behandlung von Trypanosomiasis mit dem Farbstoff Trypanrot [4]. Im Tierversuch konnte er nach der in vivo erfolgten Abtötung der Trypanosomen eine 30tägige Immunität beobachten. Bei diesen Versuchen beschrieb Ehrlich erstmalig das Auftreten von arzneifesten Stämmen als Resistenzphänomen, das heute in der gesamten Chemotherapie eine große Rolle spielt. Außerdem empfahl er bereits Kombinationen zu verwenden [5], im Sinne von "getrennt marschieren, vereint schlagen". Bald nach der Definition der selektiven Toxizität als chemotherapeutischer Quotient aus dem Verhältnis Parasitotropie zu Organotropie drückte er die Warnung vor unberechtigtem Optimismus aus: " Wir werden uns bewußt sein müssen, daß alle diese Mittel immer und immer außer den Bakterien auch andere Teile des Körpers treffen und schädigen können" [6]. Immer noch hoffte Ehrlich auf eine Therapia sterilisans magna, das heißt, daß der Körper des Kranken ohne Mithilfe seines Abwehrsystems vollständig von seinen Parasiten befreit (sterilisiert) werden könne. Dazu wäre der alte therapeutische Grundsatz "frapper fort et frapper vite" anzuwenden. Dabei schränkte er die Forderung nach der Schnelligkeit (vitesse) ein, weil nur eine größere Anzahl von geschädigten und getöteten Parasiten zu einer verstärkten Antikörperbildung führen würde. Erst 20 Jahre nach seinen Malariaversuchen konnte er mit Bertheim und Hata nach größten Schwierigkeiten und persönlichen Anfeindungen seine Salvarsantherapie (als 606. geprüftes Präparat) als vorläufigen Sieg gegen die Syphilis verkünden [7]. Mit diesem weltweiten Sensationserfolg war auch der Begriff Chemotherapie als eine Suppressionstherapie, die auf selektiver Toxizität beruht, allgemein anerkannt. Doch verstummten nicht die Vorwürfe, daß Nebenerscheinungen, wie z.B. manchmal auftretende Gelbsucht, die Patienten zu Versuchskaninchen werden ließ. Die Ethik der Chemotherapie wurde also schon am Beginn heftig diskutiert, auch gerichtliche Verfolgungen blieben nicht aus. |
|
Die weitere Geschichte der Chemotherapie ist weitgehend bekannt und beruhte immer wieder auf den Entdeckungen und Empfehlungen Paul Ehrlichs. Gerhard Domagk färbte seine Streptokokkenkultur mit dem Farbstoff Prontosil und entdeckte damit die Sulfonamide [8]. Alexander Fleming hatte schon 7 Jahre vor Domagk den Antagonismus Pilz gegen Bakterium beobachtet und nannte den dabei verantwortlichen antibiotischen, vom Pilz erzeugten Stoff Penicillin [9]. Die Antibiotikaära der Chemotherapie wurde aber erst durch das von B. Chain, H. W Florey und Mitarbeitern 1940 entwickelte Extraktionsverfahren für Penicillin eingeleitet [10]. Die geradezu unglaublich geringe Toxizität bei ebenso unglaublich starker Wirkung - es erwies sich auf die Luesspirochäte als 20.000mal wirksamer als Salvarsan - löste eine rasante Entwicklung zu einer Unzahl von Antibiotika mit einem immer breiteren Wirkspektrum gegen Bakterien aus, und man findet bakterielle Mehrfachresistenzen und schwer zu überwindende Resistenzen praktisch nur mehr im Krankenhausbereich [11]. Heute hat sich die antimikrobielle Chemotherapie auch auf das Gebiet der Virusinfektionen mit bisher noch recht bescheidenem Erfolg ausgeweitet. Die Empfehlung Paul Ehrlichs der Kombination mit verschiedenen Angriffspunkten kann hier auch bei AIDS einiges leisten. Die ethischen Probleme bei der antimikrobiellen Chemotherapie sind gering und beschränken sich fast nur auf medizinische Schwierigkeiten bei schweren oder schwer erkennbaren Infektionen. Bei schweren Infektionen mit Begleitkrankheiten bei hochbetagten Patienten stellt sich manchmal die Frage, ob es sinnvoll ist, weiter zu therapieren. Sie kann aber praktisch immer damit beantwortet werden, daß Mittel mit geringer Organotropie und starker Parasitotropie bei jedem diesbezüglichen Fall eingesetzt und nicht abgesetzt werden, da sie keine weitere Belastung für den Patienten darstellen und man einen Erfolg niemals ausschließen kann. Es kommt vor, daß ein Fall aussichtslos erscheint, und es dann doch nicht ist. So einen Fall möchte ich beschreiben: Ein junger Mann hatte einen Motorradunfall mit offener Schädelverletzung. Er wurde im tiefen Koma, praktisch apallisch, ohne auslösbare Reflexe, eingeliefert. Er blieb nach der chirurgischen und intensivmedizinischen Versorgung weiter tiefkomatös. Das ging über 9 Monate. Er mußte beatmet, künstlich ernährt werden, ließ unter sich und war dementsprechend dekubitusgefährdet. Eine Krankenschwester nahm sich mit geradezu fanatischer Intensität des jungen Mannes an, kam täglich, auch in ihrer Freizeit, um ihn umzubetten, redete auf ihn ein, hielt seine Hand und betrieb subtile Hautpflege. Trotzdem war es unvermeidlich, daß der Patient von einer Infektion in die andere fiel. Diese konnten immer wieder durch eine intensive und gezielte Antibiotikatherapie beherrscht werden. Nach neun Monaten teilte die Schwester eines Tages aufgeregt mit, daß ihr Patient zum Radio gegriffen hätte. Das war so unwahrscheinlich, daß man die sich aufopfernde Schwester nur belächelte. Aber gegen alle Wahrscheinlichkeit fing der bis dahin komplett gelähmte Patient an, sich zu bewegen. Bis auf eine Halbseitenlähmung kamen die Funktionen allmählich zurück und nach weiteren zwei Monaten konnte er in häusliche Pflege entlassen werden. Heute leitet er die Speditionsfirma seines Vaters. Neben der Infektionsbekämpfung war es vor allem die pflegende Krankenschwester, der der Patient sein Leben zu verdanken hat. Man soll eben nie aufgeben! Auch wenn die Situation nach aller Statistik aussichtslos erscheint. Der pflegerische Blick der Krankenschwester übertraf jedenfalls den ärztlichen Blick der pessimistischen Mediziner. Aufkommende Liebe spielte sicher auch eine nicht unwesentliche Rolle, und die Liebe ist nach Paracelsus und Hildegard von Bingen nach wie vor die höchste der Arzneien [12]. |
|
Ist schon der Name Anti-Biotika in unserer heutigen Bio-Mode kein glücklicher, so hat die onkologische Chemotherapie mit ihren Zytostatika einen noch erheblich schlechteren Ruf. Unvermeidliche Nebenerscheinungen, wie Übelkeit, Haarausfall, Durchfälle etc., belasten die Lebensqualität. Es belastet die Compliance, und die Patienten durchlaufen die Phasen, die Kübler-Ross so eindrucksvoll geschildert hat. Es dauert oft lange, bis ein Stadium erreicht ist, das den Willen des Patienten zu einer aktiven Mitarbeit erkennen läßt. Um einen schwerkranken Krebspatienten zu dieser zu bewegen, bedarf es zweifellos eines Handelns, das man als dialogisch bezeichnen kann. Dazu der Fall einer 40jährigen Patientin mit einem diffus metastasierenden Mammakarzinom [13]: Die Patientin war in einem erschreckenden Zustand. Ihr behandelnder Arzt hatte ihr bedauernd mitgeteilt, daß sie nur mehr drei Monate zu leben hätte und jede Therapie sinnlos wäre. Sie könnte allerdings Chemotherapie noch versuchen, aber... Die Frau war zutiefst verzweifelt. Wie sich im ersten Gespräch herausstellte, stand gar nicht die Abneigung gegen eine Chemotherapie im Vordergrund, sondern es ging ihr vor allem um ihr einziges Kind, ihre Tochter, die in drei Jahren die Reifeprüfung zu absolvieren hatte. Ohne die Hilfe der Mutter würde sie das nie schaffen. Drei Jahre müßte sie also noch leben. Sie würde alles auf sich nehmen. Eine intensive Chemotherapie wurde vereinbart, wenn auch wenig Hoffnung bestand. Kaum ein Patient hat eine Chemotherapie so ohne wesentliche Nebenerscheinungen vertragen. Bald konnten die Infusionsserien ambulant durchgeführt werden. Der Zustand der Patientin war stabil zu halten, sie konnte bald wieder ihren Haushalt bestellen und der Tochter helfen. Sie erlebte tatsächlich den positiven Schulabschluß ihres Kindes - und starb wenige Wochen nach dem ersehnten Ereignis. Es war sicher nicht allein die Chemotherapie, sondern der starke Wille, der der Patientin geholfen hatte, die entsprechend ihrem Zustand unwahrscheinlich lange Lebensspanne in erträglicher Qualität zu erhalten. Das volle Vertrauen und die intensive Mitarbeit der Patientin, wie sie im vorliegenden Fall gezeigt wurde, ist für die zytostatische Chemotherapie nur selten gegeben. Das Mißtrauen der Krebspatienten gegen diese Therapie fußt zweifellos nicht nur auf den zu erwartenden Nebenerscheinungen, sondern ist nicht zuletzt auf die doch noch eingeschränkte Wirkung von Zytostatika auf Tumore zu suchen. Als Beispiel führt Christian Dittrich an, daß 25% der Patienten sich nicht allein auf die schulmäßige Chemotherapie verlassen und zu Mitteln der Alternativ- oder Komplementärmedizin greifen. Allerdings sind es nur 2%, die Zytostatika überhaupt ablehnen. Für diese 2% entsteht dann allerdings ein schweres ethisches Problem für den Behandler [14]. Das schwerwiegendste ethische Problem der Zytostatikatherapie ist die Entscheidung für den Arzt, ob ein Patient in einem aussichtslosen Stadium überhaupt noch behandelt werden soll, ob die Chemotherapie seine restliche Lebensqualität noch verschlechtern würde oder das Ende sogar beschleunigen könnte. Diese Frage kann nur von Fall zu Fall, von Angesicht zu Angesicht zwischen Arzt und Patient entschieden werden. Bei aller Beratung, Befundung etc. bleibt diese Entscheidung dem Arzt in voller Verantwortung allein vorbehalten. Um die Möglichkeiten zur Lösung solcher Probleme klar werden zu lassen, ist eine Betrachtung über die ärztliche Ethik und das in ihr erscheinende Arzt-Patient-Verhältnis für jeden Arzt unverzichtbar. |
|
Es wurden in den Angermühler Gesprächen die "Bedingungen und Folgen der Medizinethik in unserer heutigen Gesellschaft" ausführlich diskutiert. Joseph Schmucker von Koch erklärte in einem Einleitungsreferat: "Das moderne Gesundheitswesen steht auf dem Prüfstand" [15], und er hat in Wien 1995 ein vorzügliches Referat über das Thema gehalten [16]. Horst Baier präsentierte in seinem faszinierenden, aber doch deutlich pessimistischen Vortrag vier Thesen des Werte- und Strukturwandels im postmodernen Europa, um einen Verfall der europäischen Kultur zu schrankenlosem Hedonismus zu prophezeien [17]; dem gegenüber haben die Herren Dietrich v. Engelhardt [18], Peter Kampits [19] und Fritz Hartmann [20] deutlich freundlichere Bilder von einer erstrebenswerten und durchaus möglichen positiven ärztlichen Zukunft entworfen. Natürlich steht mir die Auffassung meines Lehrers und Freundes Peter Kampits am nächsten, da er, wie ich, dialogisches Denken in der Arzt-Patient-Beziehung fordert, um damit deren ethischen Ursprung und deren Verpflichtung wieder deutlicher in die Medizin einzubringen [21]. Obwohl wir Österreicher, und schon gar wir Wiener, im Ruf stehen, weit stärker als unser nördlicher Nachbar - von dem uns, wie Karl Kraus gesagt hat, vor allem die gleiche Sprache trennt - dem Epikuräertum zuzuneigen, Wein, Weib und Gesang als bevorzugtes Lebensziel zu betrachten und Gott, Tod und Teufel in unseren Heurigenliedern verniedlichen, so kann ich mich doch mit der apokalyptischen Zukunftsvision eines "schrankenlosen Hedonismus" des Kollegen Horst Baier nicht ohne weiteres einverstanden erklären. Man lebt zwar bei uns ein wenig nach dem Spruch: "Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst", es steckt aber hinter dieser defaitistisch scheinenden Feststellung doch ein bißchen mehr. Man wäre fast verleitet zu behaupten, daß von den Berufssoziologen, die Herr Baier als Zeugen seiner Skizze anführt, ein Bild des "neuen Deutschen" vermittelt wird, die dem "österreichischen" Standpunkt näher kommt. Doch möchte ich mich nicht in einer Kritik am Pessimismus verlieren, oder die genannten Vorträge kommentieren, sondern versuchen, eine etwas optimistischere Zukunftsvision dagegen- respektive darzustellen und dabei meine Erfahrungen als langjähriger Leiter einer Universitätsklinik für Chemotherapie, die sowohl für Infektionskrankheiten als auch für onkologische Erkrankungen zuständig war, einbringen. Ich fühlte mich dabei stets der Tradition einer sogenannten Wiener Medizinischen Schule verpflichtet, obwohl schon durch die Hochspezialisierung auch an ihr ein "Wertewandel" nicht spurlos vorübergegangen ist [22]. |
|
Eine jahrzehntelange Erfahrung mit Chemotherapie, von der Zeit ihrer Anfänge in den 50er Jahren bis zur Gründung einer eigenen Universitätsklinik für Chemotherapie in Wien im Jahr 1970 und deren Leitung bis 1989, zeigte etwas deutlich: Der Arzt am Krankenbett steht in seiner Entscheidung vollkommen a l l e i n mit dem Patienten da. Nichts und niemand kann ihm die Verantwortung abnehmen, kein Laboratorium mit allen seinen Befunden, kein Konsiliarius aus welchem Fach auch immer, kein Meetingbeschluß, keine Ethikkommission und auch kein Pflegegericht oder gar ein diensthabender Staatsanwalt. Stets trifft ihn die Verantwortung selbst und in der Entscheidung nur ihn. Durch den "Primat der Klinik" und durch den "vor der Krankheit stehenden Kranken" muß tatsächlich "der Arzt ein guter Mensch" sein. Diese "Güte" hat sowohl die Bedeutung eines guten Expertentums des Fachmannes als auch die Bedeutung eines guten Mitmenschen, zu dem man als Mensch Vertrauen haben kann. So erscheint es mir wichtig, zuerst die Begriffe Ethik und Moral klarer zu trennen, als es heute üblich ist, wenn auch moralische Entscheidungen ethisch und ethische Entscheidungen moralisch sein sollten. Diese Übereinstimmung ist aber nicht zwingend, und es ist notwendig, ihre Abhängigkeiten aufzuzeigen. Moral ist immer von der Zivilisation, Kultur, Tradition, Familie, Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, Ökonomie und nicht zuletzt vom Gesetzgeber abhängig. Ethik hingegen bezieht sich ausschließlich auf autonome Personen und ihre freie Entscheidung. Ethik wird damit, wie es vor allem Emmanuel Levinas vertritt, zu einer ersten Philosophie, sowohl als Ursprung als auch als Rangordnung gemeint [26] . Konstruktivistisch, mit Francesco Varela gesehen [27], siedelt sich die Ethik stets in einer Meta-Ebene an (Ebene 1, Abb. 1). Sie bezieht sich nicht auf ein Kollektiv, sondern stets auf den Einzelfall der Person. Ethik ist nach Lévinas mit Verantwortung für den anderen als "Urphänomen der Ethik" gleichzusetzen und wird damit zur "Ersten Philosophie" [28, 29]. Die Ver-Antwortung erfolgt nach Lévinas von "Antlitz zu Antlitz", die Ethik ist eine Antwort auf das fragende Antlitz des anderen [30]. Dieser andere ist als Patient ein Hilfesuchender und ein Verwundbarer, der Ergreifen, Besitzen, und scheinbares Erkennen als Gewalt empfindet und dieser Widerstand entgegensetzt, wie dies Lévinas auch für das Erotische als "Synonyme des Könnens" beschrieben hat [31] .
Es ist unvermeidlich, durch die Einführung einer "Metaebene" in ein hier dargelegtes Schema (Abb. 1), eine schon so oft totgesagte Metaphysik wieder einzuführen. Eine Ethik, die sich ausschließlich auf autonome Einzelpersonen, nämlich Arzt und Patient, und auf deren alleinige freie Entscheidung bezieht, kann nur abgezogen von allen Detailinteressen betrachtet werden. Sie entzieht sich der Beobachtung, vielleicht sogar der Betrachtung, und kann, wie es Buber ausdrückt, nur im Innewerden der anderen Person erlebbar sein. Dies entspricht dann einer "Haltung", in der gegenseitige Verantwortung und ebenso gegenseitiges Vertrauen in voller Symmetrie erreicht werden können. Im Kreisprozeß des kreativen Zirkels, wie ihn Varela vorgeschlagen hat, erscheint die Ethik in der (Meta)-Ebene 1 als raum- und zeitlos und der Kausalität entzogen. Sie ist damit nicht greifbar für die Wissenschaft, nicht meßbar, ganz alleinstehend, nur dem Sein (und dem Nichts) verpflichtet. Sie erscheint in der Bangigkeit der Fragen des Patienten: "Kannst du mir helfen? Wirst du mir wehtun? Wirst du mir schaden? Muß ich vielleicht weiter leiden? Oder muß ich am Ende sogar sterben?", und diese Fragen erheischen Antworten. Die Antwort nimmt faßbare Gestalt an im Bereich der Moral, dem Herkömmlichen, dem geltenden Recht und der (ökonomischen?) Gerechtigkeit. In diesem Bereich des Ich-Es in der Ebene 2 ergeben sich dann die (psycho-soziologischen?) Tatsachen, die in der Richtung zu Vertrauen oder auch zu Mißtrauen lenken. In der ethischen Ich-Du-Ebene 1 kann das Vertrauen personifiziert und gefestigt oder Mißtrauen gemildert oder beseitigt werden, und das gelingt nur d i a l o g i s c h - von Antlitz zu Antlitz - mithilfe eines sich wiederholenden "kreativen Zirkels". |
| Literatur:
1. Kuemmerle H.-P., Hitzenberger G., Spitzy K.H. (Hrsg.); "Klinische Pharmakologie." ecomed, Landsberg/Lech (1992) I-1.1. 2. Spitzy K.H.: "Chemotherapie und Placebophänomen." Antibiotika Monitor VI (1990) 62. 3. Guttrnann P., Ehrlich P.; " Wir können nachweisen, daß das Methylenblau eine ausgesprochene Wirkung gegen Malaria entfaltet." "Über die Wirkung des Methylenblau bei Malaria", Berlin. klin. Wschr. (1891) in Paul Ehrlich Ges. Werke Bd. III, 15. 4. Ebenda, Ehrlich P., Shiga K.: "Farbentherapeutische Versuche bei Trypanosomenerkrankung", 24. 5. Ebenda, Ehrlich P.: "Nach meiner Ansicht besteht dieAufgabe der Chemotherapie in einer systematischen Ausbildung der Kombinationstherapie ", 105. 6. Ebenda, Ehrlich P.: "Über moderne Chemotherapie." Verh. 10. Kongreß der dtsch. derm. Ges. (1908) 141. 7. Ebenda, Ehrlich P.; "Chemotherapie." Ann. Derm. Syphilis, Paris (1913) 519. 8. Domagk G.: "Ein Beitrag zur Chemotherapie bakterieller Infektionen." Dtsche. med. Wschr. 61 (1935) 250. 9. Fleming A.: "On antibacterial action of cultures of penicillium." British I. exp. Path., 10 (1929) 226. 10. Chain E.B., Florey H. W et al.: "Penicillin as a chemotherapeutic agent." Lancet II. (1940) 226. II. Siehe auch Lorian v:: "Antibiotics in laboratory Medicine." William & Wilkins, Baltimore (1986). 12. Spitzy K.H.: "Dämon und Hoffnung. Dialogik in der Medizin." Hasel/Maudrich, Wien (1993) 60. 13. Spitzy K.H.: "Chemotherapie und Placebophänomen." a.a.O., 65. 14. Dittrich Ch.; "Alternative Behandlungsmethoden in der Onkologie." Österr. Ärztezeitung (1990) 41. 15. Schmucker von Koch J.; "Angermühler Gespräche. Medizin, Ethik, Recht." H.-R. Buchmüller (Hrsg.), Rothe, Passau (1996) Bd. 4, 8. 16. Schmucker von Koch J.: "Dialogische Anthropologie als Grundlage der Medizin im Wandel." In P. Kampits (Hrsg.): "Arzt und Patient. Dialogisches Handeln in der Medizin und seine philosophische Bedeutung." Schriftenreihe der NÖ-Landesakademie, Krems (1995) 31. 17. Ebenda, Baier H.; "Der Wertewandel im Gesundheitswesen in europäischer Perspektive. Bedingungen und Folgen für die Medizinethik." Bd. 4. 18. Ebenda, D. v. Engelhardt.; "Der Wandel der VorsteIlungen von Gesundheit und Krankheit in der Geschichte der Medizin." Bd. I. 19. Ebenda, Kampits P.; "Das dialogische Prinzip in der Arzt-Patient-Beziehung." Bd. 2. 20. Ebenda, Hartmann F.; "Mit der Krankheit leben. Über Lebenswert und Würde chronisch kranker Menschen." Bd. 3. 21. Kampits P.: "Das dialogische Prinzip in der Arzt-Patient-Beziehung." P. Kampits (Hrsg.): "Arzt und Patient. Dialogisches Handeln in der Medizin und seine philosophische Bedeutung." Schriftenreihe der NÖ-Landesakademie, Krems (1995) 45. 22. Spitzy K.H., Lau I.: "Van Swietens Erbe. Die Wiener Medizinische Schule heute in Selbstdarstellungen." Maudrich, Wien (1982). 23. Lesky E.: "Meilensteine der Wiener Medizin." Maudrich, Wien ( 1981) 131. 24. WHO, Basic Documents (1960). 25. Baier H. a.a.O.: "Vierte These", 31. 26. Siehe auch Kampits P., a.a.O. 27. Dupuy J.-P., Varela F.: "Kreative Zirkelschlüsse: Zum Verständnis der Ursprünge." In Watzlawick, Krieg (Hrsg.): "Das Auge des Beobachters. Beiträge zum Konstruktivismus." Piper, München (1991) 247. 28. Levinas E.: "Außer Sich." Alber, München (1991) 42. 29. Kampits P.: a.a.O., 30. 30. Levinas E.: "Die Spur des Anderen." Alber, Freiburg (1983). 31. Derselbe: "Die Zeit und der Andere." Meiner, Harnburg (1984) 61. 32. Gärtner H.: "Rufus von Ephesos." Akademie-Verlag, Berlin (1962) 47 ff. 33. Archimatthaeus: "De adventu medici ad aegroturn sive de instructione medici." Coll, Salern. II p.72-81 in J. Pagel: "Geschichte der Heilkunde irn Mittelalter" in Neuburger, Pagel: "Geschichte der Medizin" Bd. 1.,647. 34. Siehe auch Spitzy K.H.: "Dämon und Hoffnung." a.a.O. 35) Spitzy K.H.: "Klinische Philosophie des ärzlichen Blicks." In Kuemmerle, Hitzenberger, Spitzy: "Klinische Pharmakologie", ecorned, Landsberg/Lech (1997). 36. Spitzy K.H.: "Dämon und Hoffnung." a.a.O., 53. 37. Buber M.: "Ich und Du." Schneider, Heidelberg (1983). 38. Ebner F.: "Ges. Schriften." Seyr, München (1963). 39. Levinas E.: "Die Spur des Anderen." Alber, Freiburg (1983). 40. Siehe vor allem Theunissen M.: "Der Andere." de Gruyter, Berlin (1977). 41. Spitzy K.H.: "Klinische Philosophie."Teil 1-4, Maudrich, Wien (1993 - 1999). 42. Spitzy K.H.: "Ethische Aspekte der Chemotherapie." In "Angermühler Gespräche. Medizin, Ethik, Recht." H.-R. Buchmüller (Hrsg.), Rothe, Pas- sau (1997) Bd. 9. |
| Anschrift
des Verfassers: Univ.-Prof. DDr. K. H. Spitzy A-2520 Baden, Hochstraße 20 |